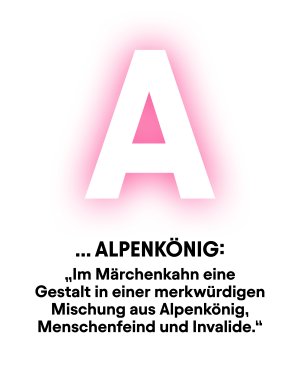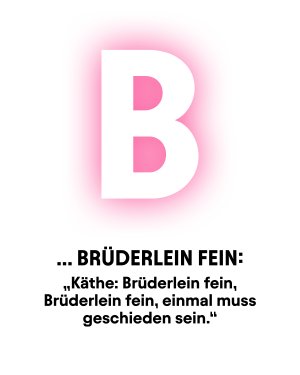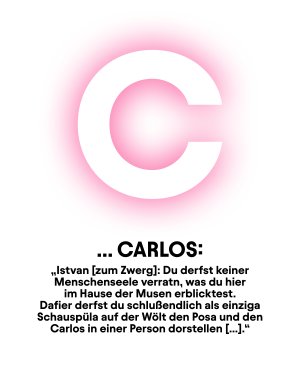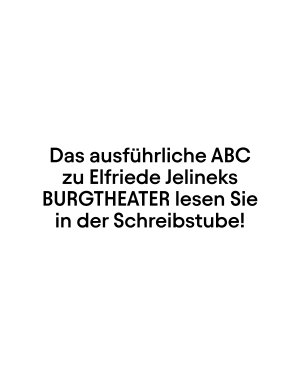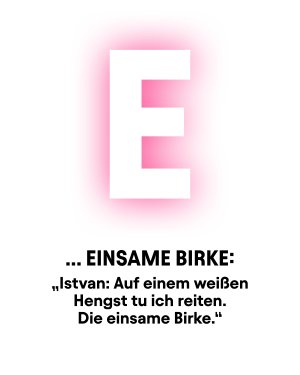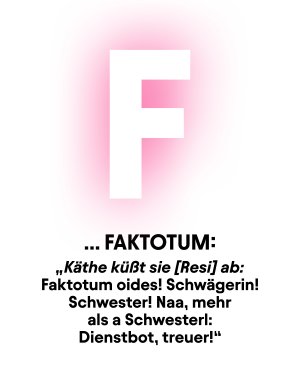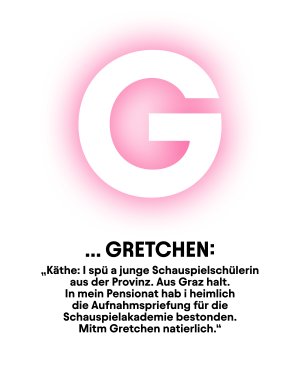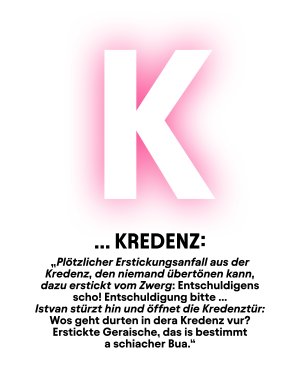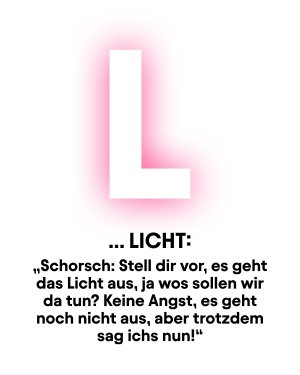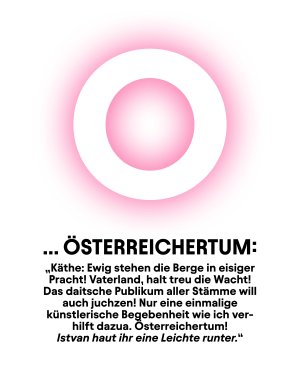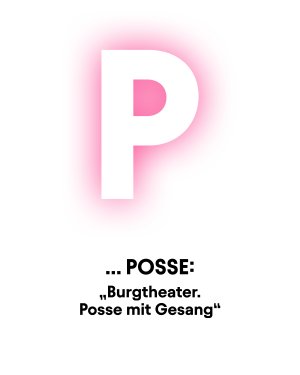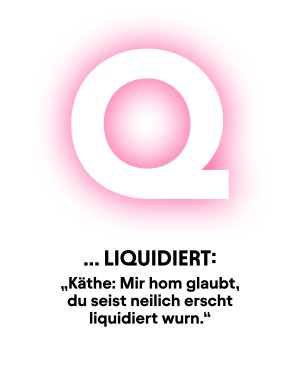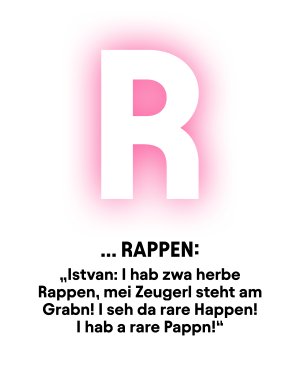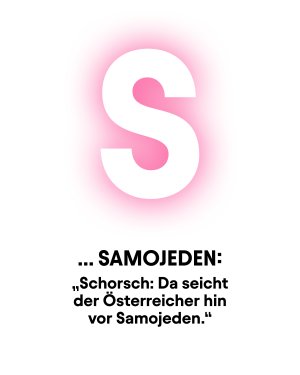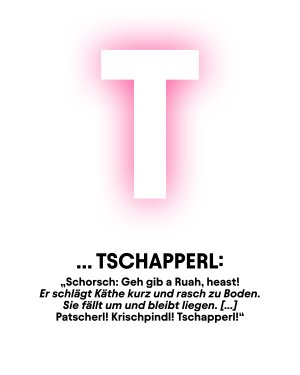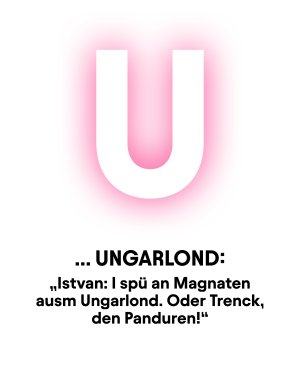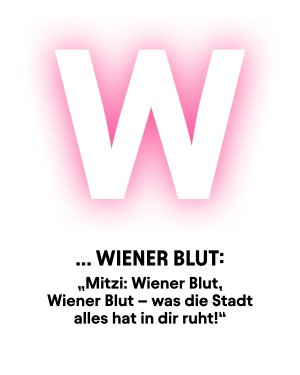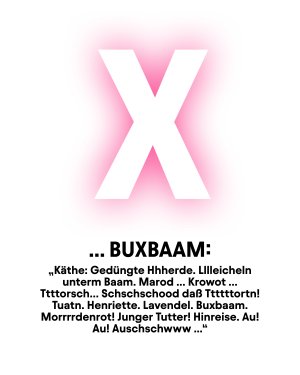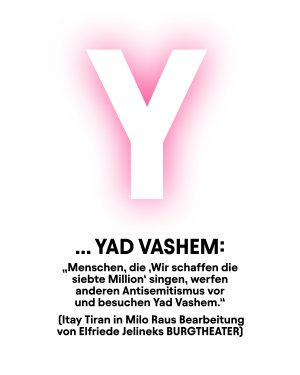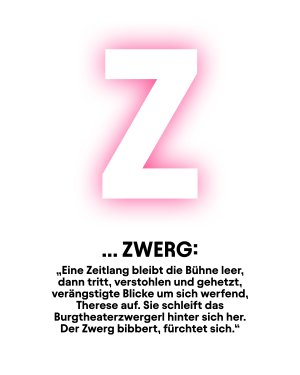Digitales Programmheft zu Burgtheater
Elfriede Jelineks BURGTHEATER – sechs Räume, sechs Kapitel, eine Inszenierung
Eine Koproduktion mit den Wiener Festwochen
„Wenn man’s in Wien aufführt, wird’s sicher der größte Theaterskandal der Zweiten Republik!“ Als Elfriede Jelinek 1981 ihr damals jüngstes Stück, eine „böse Posse mit Gesang“, ankündigte, da ahnte nicht einmal sie, dass BURGTHEATER auch ohne die eigentlich geplante Premiere im Burgtheater ihren Ruf als „Nestbeschmutzerin“ begründen sollte. Eine berühmte Schauspielerfamilie, Geraunze und Geraune in mörderischer Kunstsprache: Für den Schweizer Regisseur und Wiener Festwochen-Intendanten Milo Rau, dem Jelinek nun exklusiv die Rechte für eine späte Burgtheater-Premiere einräumte, werden dies nur einige der Ausgangspunkte für ein größeres szenisches Panoptikum sein: Öffentlichkeit und Anpassung, Geschichte (der BURG, des Theaters und Europas), Faschismus und Verdrängung.
BURGTHEATER
nach Elfriede Jelinek
In einer Bearbeitung von Milo Rau und Ensemble
MIT
Mavie Hörbiger
Annamária Láng
Birgit Minichmayr
Caroline Peters
Safira Robens
Itay Tiran
Tilman Tuppy
UND
Maja Karolina Franke
Alla Kiperman
Willfried Kovárnik
KOMPARSERIE
Thomas Bäuml, Stephanie Gabriele Eipeltauer, Marlies Magdalena Nageler, Ortrun Obermann-Slupetzky, Agnieszka Salamon, Franz Schöffthaler
KINDER DER KOMPARSERIE
Clara Lackner-Zinner, Dora Staudinger
LIVE-KAMERA
Eduardo Triviño Cely, Andrea Gabriel, Mariano Margarit
REGIE
Milo Rau
BÜHNE
Anton Lukas
KOSTÜME
Cedric Mpaka
MUSIK
Elia Rediger
VIDEO
Moritz von Dungern
LICHT
Reinhard Traub
DRAMATURGIE
Claus Philipp, Markus Edelmann
REGIEASSISTENZ Nastasia Griese, Claus Nicolai Six PRODUKTIONSBETREUUNG BÜHNE Claudia Vallant KOSTÜMASSISTENZ Marie Therese Fritz, Lino Pflug REGIEHOSPITANZ Merle Proll BÜHNENBILDHOSPITANZ August Eckmann KOSTÜMHOSPITANZ Jannik Haller REGIEVOLONTARIAT Valerian Zimmermann LEITUNG KOMPARSERIE Thelma Rán Guðbjargardóttir KINDERBETREUUNG Marlene Glösmann INSPIZIENZ Dagmar Zach SOUFFLAGE Barbara Emilia Dauer GRUPPENMEISTER Thomas Graf SCHNÜRBODEN Hermann Skorpis BELEUCHTUNG Rainer Hösel TONTECHNIK Barbara Huber, Ludwig Klossek VIDEOTECHNIK Victoria Aichhorn, Florian Dolzer REQUISITE Christoph Putz, Michael Schätz ABENDGARDEROBE Christian Kukla, Elisa Katharina Lehner, Lena Elisabeth Meyer, Gabriele Moser ABENDMASKE Denice Laube, Antonia Peix, Alexandra Polzhofer, Helena Stiegler
TECHNISCHE LEITUNG BURGTHEATER Johann Krainz BÜHNENINSPEKTOR Peter Wiesinger BÜHNENKONSTRUKTION Hubert Kalina, Ulrike Müller (Karenz), Florian Persché GESAMTLEITUNG BELEUCHTUNG Michael Hofer STELLVERTRETENDE LEITUNG BELEUCHTUNG BURGTHEATER Rainer Hösel, Gerhard Mühlhauser, Roman Sobotka GESAMTLEITUNG REQUISITE Christian Schober LEITUNG MUSIKABTEILUNG Alexander Nefzger GESAMTLEITUNG TONABTEILUNG & MULTIMEDIA David Müllner LEITUNG TON BURGTHEATER Christian Strnad LEITUNG MULTIMEDIA Andreas Rathammer GESAMTLEITUNG KOSTÜM & GARDEROBE Werner Fritz LEITUNG GARDEROBE Christian Raschbach INTERIMISTISCHE LEITUNG MASKE Helmut Lackner INTERIMISTISCHE STELLVERTRETENDE LEITUNG MASKE Brigitte Hörbiger DEKORATIONS-/KOSTÜMHERSTELLUNG ART for ART Theaterservice GmbH LEITUNG KOSTÜMWERKSTATT Stephanie Freyschlag, Barbara Pfeiler PROJEKTLEITUNG KOSTÜME Gerda Taberhofer LEITUNG DEKORATIONSWERKSTÄTTEN Hendrik Nagel PROJEKTLEITUNG BÜHNE Sophie Köhler
Dieses Programmheft ist der Auftakt für eine Reihe digitaler Programmhefte, die ab der Spielzeit 2025/26 für ausgewählte Stücke angeboten werden. Feedback, Anregungen & Wünsche schreiben Sie gerne an: online@burgtheater.at
Weitere Texte von Elfriede Jelinek finden Sie auf www.elfriedejelinek.com
Die Wochenzeitung Die Furche hat für dieses Programmheft die Kolumne, in der sich Elisabeth Orth, die älteste Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger, in die Debatte um BURGTHEATER einbringt, kostenlos zur Nachlese zu Verfügung gestellt: https://www.furche.at/meinung/liebe-eltern-6976381
Redaktion: Anne Aschenbrenner, Markus Edelmann & Claus Philipp
Mitarbeit: Cedric Baumann
Vielleicht entsteht aus diesem Sturm der Entrüstung und Schadenfreude, der Denunziationslust und der Ahnungslosigkeit unserem Beruf gegenüber durch dieses Stück eine klärende Diskussion, die dem momentanen Zustand dieses Landes gut anstünde.Elisabeth Orth in: Die Furche am 22. November 1985
Die KANTINE

DIE BONNER KULISSE

Das Intendantenbüro