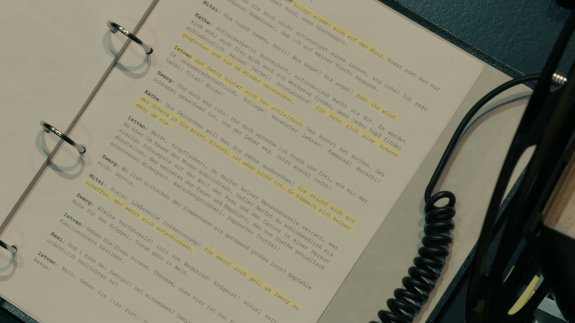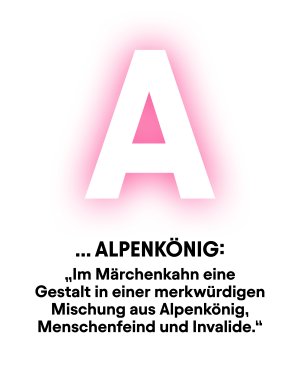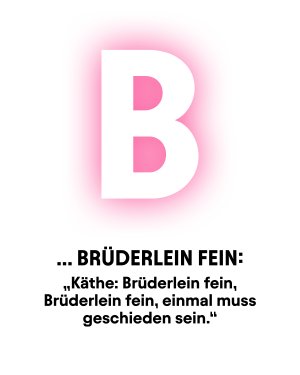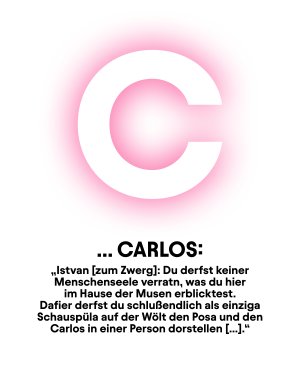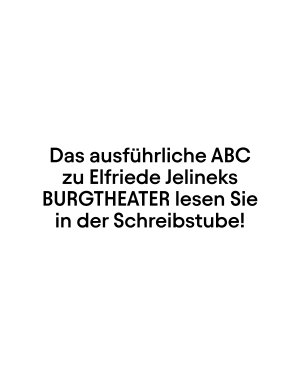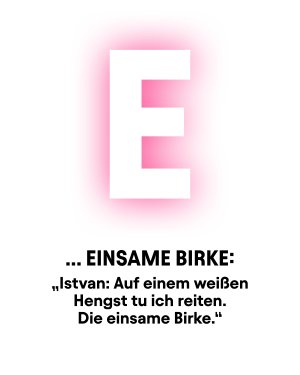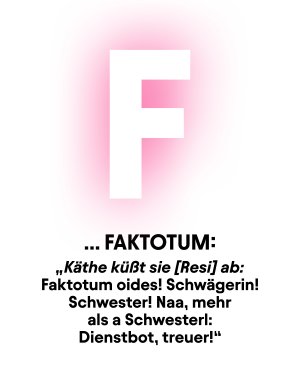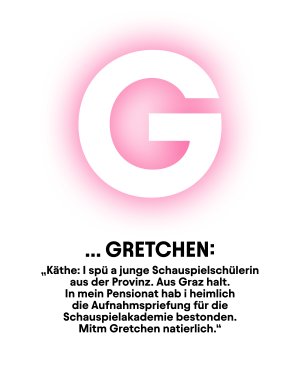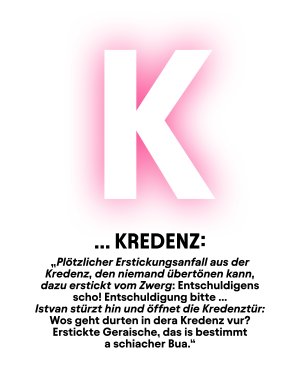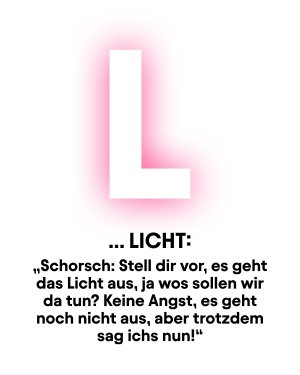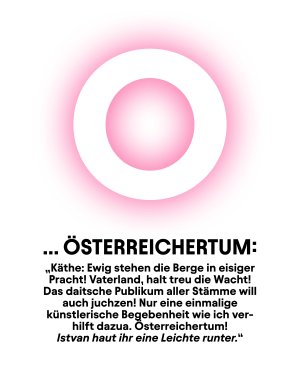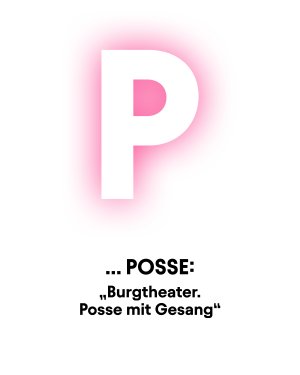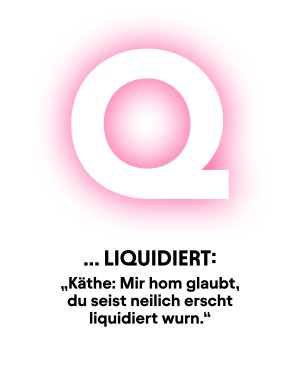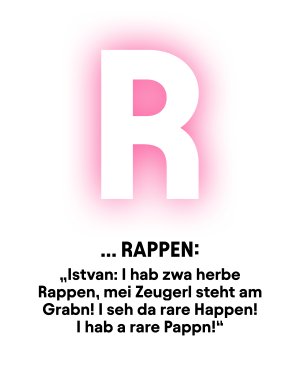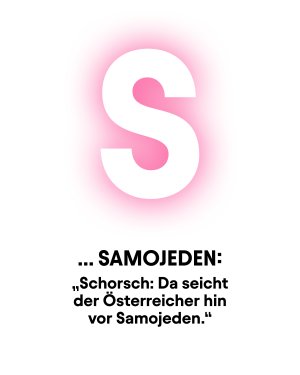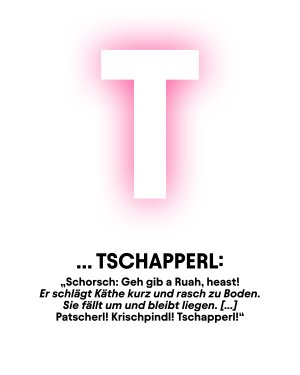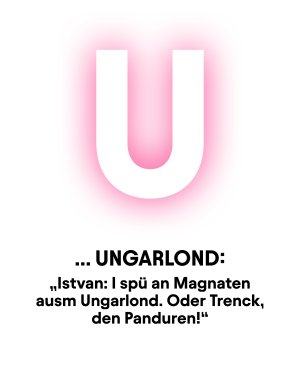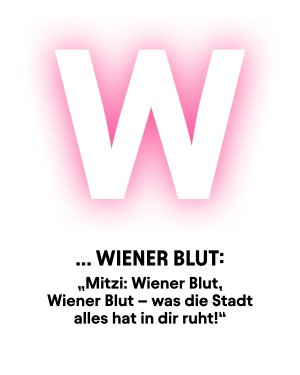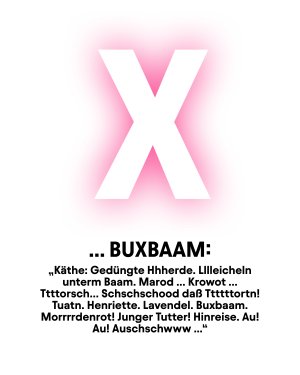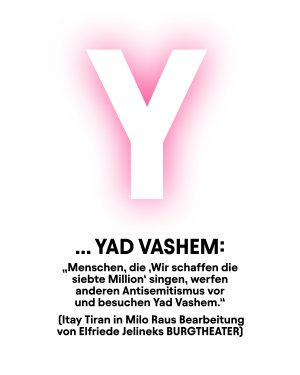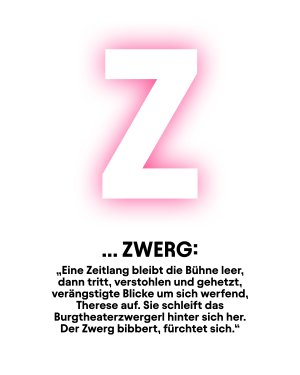Termine Festabonnement
Hier finden Sie die Termine unserer Festabonnements der Saison 2025 2026
BURGTHEATER
- 23.09.2025
- 18.11.2025
- 10.02.2026
- 07.04.2026
- 30.06.2026
- 30.09.2025
- 25.11.2025
- 23.12.2025
- 17.03.2026
- 14.04.2026
- 14.10.2025
- 02.12.2025
- 24.02.2026
- 21.04.2026
- 16.06.2026
- 16.09.2025
- 11.11.2025
- 13.01.2026
- 03.03.2026
- 26.05.2026
- 24.10.2025
- 19.12.2025
- 13.02.2026
- 08.05.2026
- 26.06.2026
- 10.10.2025
- 28.11.2025
- 23.01.2026
- 20.02.2026
- 17.04.2026
- 12.09.2025
- 07.11.2025
- 02.01.2026
- 27.02.2026
- 24.04.2026
- 19.09.2025
- 17.10.2025
- 12.12.2025
- 06.03.2026
- 29.05.2026
- 24.09.2025
- 22.10.2025
- 17.12.2025
- 11.02.2026
- 06.05.2026
- 01.10.2025
- 21.01.2026
- 18.03.2026
- 13.05.2026
- 10.06.2026
- 17.09.2025
- 05.11.2025
- 14.01.2026
- 25.03.2026
- 20.05.2026
- 15.10.2025
- 03.12.2025
- 04.02.2026
- 29.04.2026
- 24.06.2026
- 20.10.2025
- 15.12.2025
- 16.02.2026
- 27.04.2026
- 29.06.2026
- 13.10.2025
- 24.11.2025
- 19.01.2026
- 09.03.2026
- 08.06.2026
- 06.10.2025
- 29.12.2025
- 23.02.2026
- 23.03.2026
- 18.05.2026
- 03.11.2025
- 05.01.2026
- 02.03.2026
- 20.04.2026
- 22.06.2026
- 25.09.2025
- 13.11.2025
- 12.02.2026
- 09.04.2026
- 18.06.2026
- 09.10.2025
- 20.11.2025
- 22.01.2026
- 12.03.2026
- 16.04.2026
- 11.09.2025
- 04.12.2025
- 26.02.2026
- 23.04.2026
- 11.06.2026
- 18.09.2025
- 27.11.2025
- 08.01.2026
- 26.03.2026
- 28.05.2026
- 21.09.2025
- 23.11.2025
- 18.01.2026
- 15.03.2026
- 31.05.2026
- 07.09.2025
- 09.11.2025
- 22.02.2026
- 19.04.2026
- 14.06.2026
- 14.09.2025
- 12.10.2025
- 11.01.2026
- 15.02.2026
- 03.05.2026
- 28.09.2025
- 07.12.2025
- 08.03.2026
- 17.05.2026
- 28.06.2026
- 26.09.2025
- 06.11.2025
- 11.12.2025
- 13.03.2026
- 19.06.2026
- 05.10.2025
- 21.12.2025
- 25.01.2026
- 01.03.2026
- 26.04.2026
AKADEMIETHEATER
- 07.10.2025
- 27.01.2026
- 24.02.2026
- 21.04.2026
- 09.06.2026
- 14.10.2025
- 09.12.2025
- 03.02.2026
- 03.03.2026
- 26.05.2026
- 23.09.2025
- 11.11.2025
- 30.12.2025
- 10.03.2026
- 05.05.2026
- 30.09.2025
- 04.11.2025
- 20.01.2026
- 17.02.2026
- 12.05.2026
- 12.09.2025
- 07.11.2025
- 30.01.2026
- 27.03.2026
- 24.04.2026
- 17.10.2025
- 14.11.2025
- 09.01.2026
- 06.03.2026
- 12.06.2026
- 26.09.2025
- 05.12.2025
- 13.02.2026
- 10.04.2026
- 19.06.2026
- 05.09.2025
- 10.10.2025
- 16.01.2026
- 20.03.2026
- 22.05.2026
- 10.09.2025
- 03.12.2025
- 25.02.2026
- 15.04.2026
- 17.06.2026
- 22.10.2025
- 10.12.2025
- 04.03.2026
- 01.04.2026
- 24.06.2026
- 24.09.2025
- 19.11.2025
- 17.12.2025
- 11.03.2026
- 27.05.2026
- 17.09.2025
- 26.11.2025
- 21.01.2026
- 18.02.2026
- 22.04.2026
- 08.09.2025
- 01.12.2025
- 02.02.2026
- 23.03.2026
- 15.06.2026
- 06.10.2025
- 22.12.2025
- 30.03.2026
- 27.04.2026
- 22.06.2026
- 20.10.2025
- 17.11.2025
- 12.01.2026
- 09.02.2026
- 13.04.2026
- 22.09.2025
- 27.10.2025
- 15.12.2025
- 16.03.2026
- 11.05.2026
- 11.09.2025
- 06.11.2025
- 29.01.2026
- 12.03.2026
- 21.05.2026
- 23.10.2025
- 11.12.2025
- 08.01.2026
- 30.04.2026
- 25.06.2026
- 18.09.2025
- 27.11.2025
- 12.02.2026
- 09.04.2026
- 28.05.2026
- 02.10.2025
- 04.12.2025
- 05.02.2026
- 19.03.2026
- 07.05.2026
- 19.10.2025
- 16.11.2025
- 04.01.2026
- 01.03.2026
- 26.04.2026
- 12.10.2025
- 30.11.2025
- 11.01.2026
- 29.03.2026
- 31.05.2026
- 28.09.2025
- 23.11.2025
- 21.12.2025
- 15.03.2026
- 10.05.2026
- 05.10.2025
- 18.01.2026
- 15.02.2026
- 19.04.2026
- 14.06.2026
Kontakt
Abo-Service
- Telefon
- E-Mail Adresse
-
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten:1. Juli bis 24. August
Mo bis Fr: 10 – 14 Uhr
Do: 10 – 17 Uhr
Sa, So, Feiertag: geschlossen
Wahlabo Vorverkauf September
05. August: 10 - 17 Uhr
ab 25. August
Mo bis Fr: 10 – 18 Uhr
Sa, So, Feiertag: geschlossen
-
Anschrift
Burgtheater | Eingang Vestibül
Universitätsring 2
1010 Wien