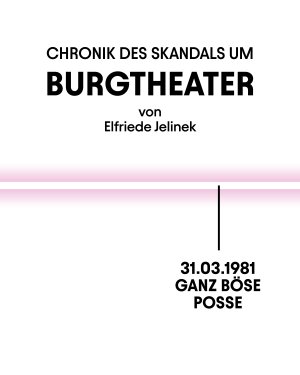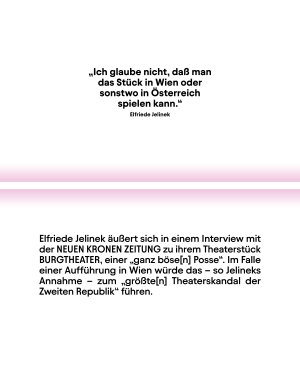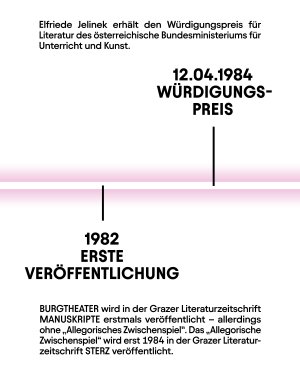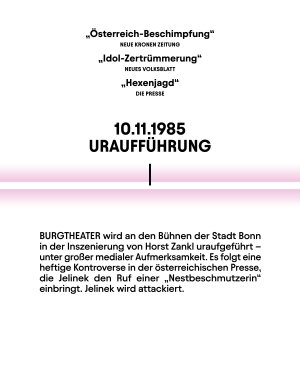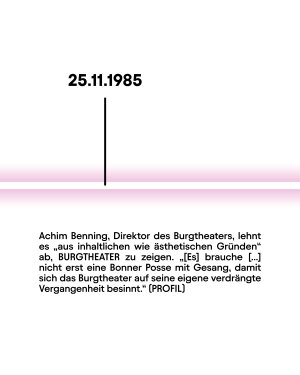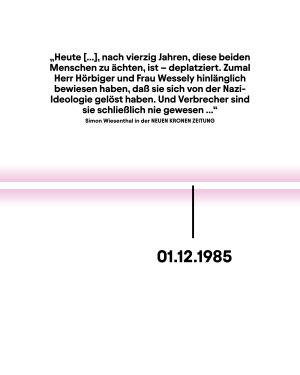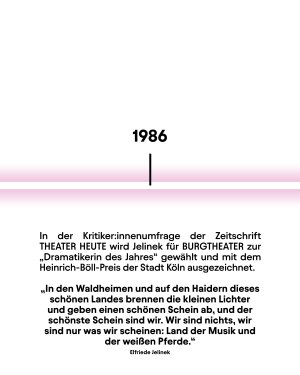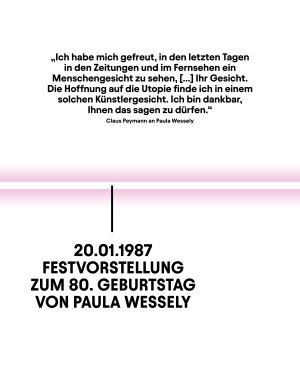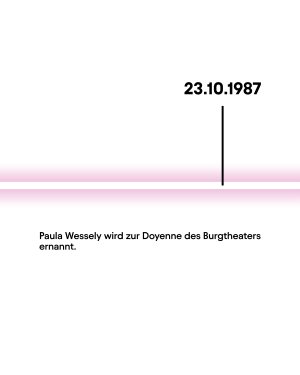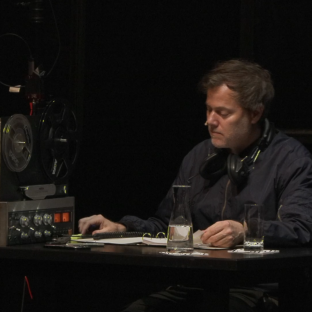Im Januar vorigen Jahres stieß ich anlässlich eines bevorstehenden Umzugs beim Ausräumen des Kellers auf eine alte Schuhschachtel. Als ich sie öffnete, fand ich darin eine Sammlung von Tagebüchern aus meiner Kindheit. Dazwischen entdeckte ich ein dünnes, selbstgebundenes Heft mit der Aufschrift Gedichtband, mit einem Bleistift auf das Deckblatt geschrieben. Es handelte sich um ein kleines Büchlein aus DIN A5-Papier, fünf Blätter, in der Mitte gefaltet und mit einem Tacker zusammengeheftet. Unter dem Titel verliefen zwei krakelige, zinnenförmige Linien: eine begann links und stieg in sechs Stufen nach oben, die andere senkte sich gegenläufig in sieben Stufen nach rechts unten herab. War es der Versuch, ein Titelbild zu gestalten, oder bloß spielerisches Gekritzel? Auf der Rückseite des Heftes standen die Jahreszahl 1979 und mein Name. Im Inneren befanden sich acht Gedichte, in derselben ordentlichen Handschrift wie das Titelblatt geschrieben, und den unteren Rand zierte jeweils das Datum, in chronologischer Reihenfolge. Zwischen den typisch naiven und unbeholfenen Sätzen einer Achtjährigen, stach ein Gedicht besonders hervor, datiert vom April.
Es begann mit folgenden zwei Versen:
Wo könnte die Liebe sein?
In meinem pochenden Herzen ist sie verborgen.
Was ist Liebe?
Ein goldener Faden, der Herz mit Herz verbindet.
Augenblicklich wurde ich vierzig Jahre zurückversetzt zu jenem Nachmittag, an dem ich das Büchlein angefertigt hatte: Ein Stummelbleistift, der in einer Kugelschreiberkappe steckte, Radiergummikrümel und der große Metallhefter, den ich heimlich aus dem Arbeitszimmer meines Vaters entwendet hatte. Ich erinnere mich daran, es war kurz nachdem ich von unserem bevorstehenden Umzug nach Seoul erfahren hatte, dass ich die Gedichte, die ich auf Ränder von Notizblättern, Heften und Übungsbüchern, sowie an verschiedene Stellen meines Tagebuchs gekritzelt hatte, sammeln und zusammenstellen wollte. Auch daran, dass ich sie, als ich diese Sammlung von Gedichten schließlich fertiggestellt hatte, aus irgendeinem Grund niemandem hatte zeigen wollen.
Ehe ich die Tagebücher und das Heft wieder zurück in die Schuhschachtel legte und den Deckel schloss, fotografierte ich die Seite mit diesen Versen mit dem Handy. Einige der Worte, die ich mit acht Jahren gewählt hatte, schienen in Verbindung mit meinem heutigen Selbst zu stehen: In meiner Brust, mein schlagendes Herz. Zwischen unseren Herzen. Ein goldener Faden, der sie verbindet – ein Faden, der Licht ausstrahlt.
Vierzehn Jahre später, als ich zum ersten Mal Gedichte und im darauffolgenden Jahr eine Kurzgeschichte veröffentlichte, wurde ich zu einem Homo scribens. Fünf Jahre danach, etwa drei davon angefüllt mit Arbeit, erschien mein erster Roman. Obwohl ich Gedichte und Kurzgeschichten immer liebte – und noch heute liebe – verspüre ich eine besondere Faszination für das Schreiben von Romanen.
Einen Roman zu schreiben dauert erfahrungsgemäß zwischen einem und sieben Jahren und verlangt einen Tausch: meine Zeit, mein Leben, gegen die intensive Auseinandersetzung mit den drängenden Fragen, mit denen ich mich im Werk auseinandersetze. Diese Hingabe empfinde ich als bereichernd. Genau das hat mir gefallen. Es war für mich eine bewusste Entscheidung, diese Zeit mit wichtigen und dringenden Fragen zu verbringen, in die ich eintauchen und bei denen ich verweilen kann. Jeder Roman beginnt für mich mit Fragen, denen ich mich während des Schreibprozesses stelle, ich muss sie ertragen und mit ihnen leben. Das Schreiben endet nicht damit, dass ich Antworten darauf finde, sondern vielmehr an einem Punkt, an dem ich das Ende dieser Fragen erreiche und mich durch sie verändert fühle. Ich kehre nie als dieselbe Person zurück, die den Roman begonnen hat. Sobald ich aus dem Vorgang des Schreibens verändert hervorgehe, beginnt der Prozess von neuem. Neue Fragen knüpfen an die alten an, sie verbinden sich wie Glieder einer Kette oder überlappen einander wie Dominosteine und bewegen mich zu einem neuen Roman. Zwischen 2003 und 2005 schrieb ich meinen dritten Roman DIE VEGETARIERIN. Während dieser Zeit stellte ich mich schmerzvollen Fragen: Kann ein Mensch vollkommen unschuldig sein? Wie tief kann unser Widerstand gegen Gewalt gehen? Was geschieht mit einem Menschen, der sich so radikal von der Menschheit abwendet, dass er nicht länger Teil ihrer Spezies sein möchte?
Die Hauptperson Yeong-Hye lehnt sich gegen Gewalt auf, indem sie aufhört, Fleisch zu essen, und schließlich glaubt, sie sei eine Pflanze, die nichts außer Wasser benötigt. Sie befindet sich in der paradoxen Situation, dass sie sich Schritt für Schritt dem Tod nähern muss, um sich zu retten. Ihre Schwester In-Hye, die Co-Protagonistin des Romans, durchlebt mit ihr albtraumhafte Momente und Augenblicke des Zerbrechens, bis sie schließlich miteinander vereint sind.
In der Welt dieses Romans habe ich mir gewünscht, dass Yeong-Hye am Ende überlebt, weshalb die letzte Szene im Krankenwagen spielt. Dieser fährt durch Wälder, vorbei an Bäumen, die wie brennende grüne Flammen leuchten. Die ältere Schwester blickt aus dem Fenster, vielleicht in Erwartung einer Antwort, vielleicht aus Protest. Das gesamte Werk verharrt in einer Pose des Widerstands und der Suche nach Antworten. Starrend, trotzig, auf Antworten wartend.
Der folgende Roman, GEH, DER WIND ERHEBT SICH, greift diese Fragen auf und geht noch darüber hinaus. Man kann sich der Gewalt nicht dadurch entziehen, dass man das Leben und die Welt gleichermaßen ablehnt. Es ist uns schlichtweg unmöglich, zu Pflanzen zu werden. Wie also sollen wir weitermachen? In diesem Kriminalroman, in dem Sätze in kursiver und nicht-kursiver Schrift aufeinanderprallen, riskiert die Hauptperson, die lange gegen den Schatten des Todes angekämpft hat, ihr Leben, um zu beweisen, dass der Tod einer Freundin kein Selbstmord war. In der letzten Szene schleppt sie sich auf dem Bauch liegend davon, nachdem sie mit letzter Kraft die Gewalt und den Tod überwunden hatte, wobei ich mir folgende Fragen stellte: Müssen wir nicht am Ende überleben? Sollte unser Leben nicht Zeugnis geben dafür, was wahr ist?
Der fünfte Roman, GRIECHISCHSTUNDEN, geht noch weiter. Wenn wir wirklich in dieser Welt ums Überleben kämpfen müssen, ab welchem Punkt ist das möglich? Eine Frau, die ihre Stimme verloren hat, und ein Mann, der allmählich erblindet, gehen in ihrer eigenen Einsamkeit durch die Finsternis, bis sie sich gegenseitig erkennen. Als ich diesen Roman schrieb, wollte ich mich auf taktile Momente konzentrieren. In der Dunkelheit und Stille bewegt sich die Geschichte im Zeitlupentempo auf eine Szene zu, in der die Frau, mit bis zum Fingeransatz gekürzten Nägeln einige Worte in die Handfläche des Mannes schreibt. Im Licht dieses Augenblicks, der sich zu einer Ewigkeit zu dehnen scheint, offenbaren die beiden einander ihre verletzlichste Seite. Während ich diesen Roman schrieb, drehte es sich für mich um die Frage: Wenn wir auf den zartesten Teil eines Menschen blicken – wenn wir die unbestreitbare Wärme spüren – können wir nicht letztlich dadurch in dieser vergänglichen und gewalttätigen Welt überleben?
Am Ende dieser Fragen stellte ich mir bereits den nächsten Roman vor. Es war Frühling 2012, nach Veröffentlichung von GRIECHISCHSTUNDEN. Ich dachte, ich würde ein Buch schreiben, das einen Schritt weiter auf Licht und Wärme zugeht. Einen Roman, der das Leben und die Welt umarmt und mit einer strahlend klaren Empfindung auflädt. Doch als ich den Titel gefunden und etwa zwanzig Seiten geschrieben hatte, musste ich innehalten, als mir klar wurde, dass etwas in mir existierte, das es mir unmöglich machte, diesen Roman fortzuführen.
Bis zu jenem Zeitpunkt hatte ich nie daran gedacht, über Gwangju zu schreiben.
Im Januar 1980 verließ ich die Stadt mit meiner Familie, und weniger als vier Monate später ereignete sich dort ein Massaker. Ich war damals neun Jahre alt. Einige Jahre später, mit zwölf, entdeckte ich zufällig ein Gwangju-Fotobuch, das verkehrt herum in einem Bücherregal steckte, und las es heimlich, ohne dass die Erwachsenen es mitbekamen. Es war ein Buch, das im Verborgenen von den Hinterbliebenen und Überlebenden erstellt und verbreitet wurde, die gegen die strenge Medienzensur der damaligen Militärregierung und die Verzerrung der Wahrheit Beweise zusammentrugen. Es enthielt Fotos von Bürgern und Studenten, die durch Knüppel, Bajonette und Schüsse getötet worden waren, als sie den Putschisten des neuen Militärregimes Widerstand geleistet hatten. Als Kind konnte ich die politische Tragweite dieser Bilder nicht vollständig erfassen. Doch die entstellten Gesichter formten sich in meinen Gedanken zu einer grundlegenden Frage über die Menschheit: Sind Menschen wirklich bereit, anderen so etwas anzutun? Gleichzeitig gab es weitere Bilder, die eine ganz andere Frage in mir aufkommen ließen. Es waren Aufnahmen von Menschen zu sehen, die sich vor einem Universitätskrankenhaus in einer endlosen Schlange anstellten, um Blut für die Schussverletzten zu spenden. Sind Menschen wirklich bereit, so etwas füreinander zu tun?
Diese beiden Fragen, deren Antworten mir unvereinbar schienen, prallten aufeinander und bildeten ein unlösbares Rätsel.
Also, im Frühjahr 2012, an jenem Tag, an dem ich mich abmühte, einen strahlend hellen, lebensbejahenden Roman zu schreiben, stieß ich wieder auf jene Fragen, die niemals gelöst worden waren. Lange zuvor hatte ich mein Grundvertrauen in die Menschheit verloren. Doch wie konnte ich dann die Welt umarmen? Es war der Moment, in dem ich erkannte, dass ich diesem unmöglichen Rätsel nicht ausweichen konnte und es mir nur durch Schreiben gelingen würde, diese Fragen zu durchdringen und so endlich weiterzukommen.
In den folgenden fast zwölf Monaten skizzierte ich den neuen Roman, den ich zu schreiben gedachte, und stellte mir vor, dass das Massaker von Gwangju im Mai 1980 als eine Erzählebene in den Roman eingebettet würde. Dann, im Dezember desselben Jahres, besuchte ich den Friedhof in Mangweol-dong. Der Tag war bereits vorangeschritten und es hatte heftig geschneit. Als es dunkel wurde, legte ich meine Hand auf mein Herz und ging über den gefrorenen Friedhof. In diesem Augenblick dachte ich: Vergiss das mit der einzelnen Erzählebene, ich werde einen Roman schreiben,der Gwangju direkt behandelt.
Ich besorgte mir ein Buch, das die Zeugnisse von fast 900 Menschen enthielt, und las es etwa neun Stunden am Tag, einen ganzen Monat lang, bis ich es vollständig durchgearbeitet hatte. Danach las ich nicht nur über Gwangju, sondern auch über andere Beispiele von Staatsgewalt, erweiterte meinen Blick auf Orte und Zeiträume und las Bücher über Massaker, wie sie sich weltweit im Laufe der Geschichte wiederholt haben.
Während dieser Recherchephase kamen mir zwei Fragen in den Sinn, die ich als Mitzwanzigerin immer auf die erste Seite meines Tagebuchs notiert hatte, wenn ich ein neues anfing.
Kann die Gegenwart der Vergangenheit helfen?
Können die Lebenden die Toten retten?
Je mehr Material ich las, desto unmöglicher erschien es, diese Fragen zu beantworten. Der fortwährende Kontakt mit den dunkelsten Aspekten des Menschseins führte dazu, dass mein Glaube daran, von dem ich dachte, er sei schon erschüttert, endgültig zu Bruch ging und in Scherben lag. Als ich fast aufgeben wollte und dachte, dass ich mit diesem Roman nicht mehr vorankommen würde, las ich das Tagebuch eines jungen Lehrers an einer Abendschule. Park Yong-Dschun, ein schüchterner und ruhiger Mann, der während des Massakers in Gwangju im Mai 1980 an der Absoluten Gemeinschaft der Bürgerselbstverwaltung teilgenommen hatte. Die Soldaten hatten sich für zehn Tage zurückgezogen, und als ihre Rückkehr angekündigt wurde, hatte er bis zum Morgen im YWCA neben dem Sitz der Provinzverwaltung ausgeharrt, wo er schließlich ermordet wurde. Noch in der Nacht vor seiner Ermordung hatte er folgendes niedergeschrieben: Gott, warum habe ich ein Gewissen, das mich so sticht und verletzt? Ich will leben.
In dem Moment, als ich diese Sätze las, wusste ich blitzartig, welche Richtung dieser Roman einschlagen musste. Ich erkannte auch, dass ich die Fragestellung umdrehen musste.
Kann die Vergangenheit der Gegenwart helfen?
Können die Toten die Lebenden retten?
Während ich dieses Buch schrieb, gab es Momente, in denen ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass die Vergangenheit der Gegenwart hilft und die Toten die Lebenden retten. Danach besuchte ich immer wieder den Friedhof, und merkwürdigerweise war das Wetter jedes Mal klar. Wenn ich die Augen schloss, war der orangefarbene Schein der Sonne auf der Innenseite meiner Augenlider zu spüren. Ich empfand das als das Licht des Lebens. Unbeschreiblich warmes Licht und Luft umhüllten meinen Körper.
Die Fragen, die sich mir als Zwölfjähriger nach dem Blick in das Fotobuch stellten, waren diese: Wie kann der Mensch so gewalttätig sein? Gleichzeitig, wie kann der Mensch sich gegen eine so überwältigende Gewalt stellen? Was bedeutet es, zur menschlichen Gattung zu gehören? Um die unmögliche Brücke zwischen dem Elend und der Würde des Menschen zu überqueren, war die Hilfe der Toten notwendig. So wie der junge Dong-Ho, der die Hand seiner Mutter fest ergriff und in Richtung des Sonnenlichts ging.
Selbstverständlich konnte ich nichts von dem ungeschehen machen, was den Verstorbenen, den Hinterbliebenen und den Überlebenden widerfahren war. Alles, was ich tun konnte, war, meine Sinne, Emotionen und mein Leben zur Verfügung zu stellen. Da ich am Anfang und Ende des Romans eine Kerze entzünden wollte, begann die erste Szene in dem Gebäude Sangmugwan, in dem damals die Leichen gesammelt und die Bestattungen vorbereitet wurden. Dort deckt der fünfzehnjährige Junge Dong-Ho die Leichname mit weißen Tüchern zu und zündet jedem eine Kerze an. Er starrt in die Mitte der flackernden Flamme, die an ein blassblaues Herz erinnert.
Der Roman MENSCHENWERK lautet auf Koreanisch DER JUNGE KOMMT. Das Verb im Titel steht in der Gegenwartsform. In dem Moment, in dem er mit du oder Sie angesprochen wird, erwacht der Junge in der Dunkelheit und nähert sich einer Seele in der Gegenwart. Er kommt immer näher und wird schließlich gegenwärtig. Als ich die Zeit und den Raum, in denen menschliche Grausamkeit und Würde in extremster Form nebeneinander existierten, mit Gwangju bezeichnete, verstand ich beim Schreiben des Buchs, dass Gwangju nicht länger der Eigenname einer Stadt war, sondern ein allgemeiner Begriff, der Zeit und Raum durchquert und immer wieder zu uns zurückkehrt – auch jetzt, in diesem Moment.
Als ich MENSCHENWERK im Frühling 2014 endlich vollendet hatte und das Buch im Mai desselben Jahres veröffentlicht worden war, überraschten mich Leser mit ihrem Bekenntnis, dass sie beim Lesen dieses Romans Pein empfanden. Ich musste darüber nachdenken, wie mein Schmerz beim Schreiben dieses Buches mit der Pein dieser Leser verbunden war. Was war der Grund für unser Leiden? Wollen wir an die Menschlichkeit glauben, und fühlen wir uns zerstört, wenn dieser Glaube ins Wanken gerät? Fühlen wir Schmerz, wenn die Liebe zu Menschen zerbricht, weil wir lieben wollen? Entsteht Schmerz aus der Liebe, und ist mancher Schmerz womöglich ein Beweis dafür, dass wir lieben?
Im Juni desselben Jahres hatte ich einen Traum. Es war der Traum von einem weiten Feld, auf dem feiner, starker Schnee fiel. Über das ganze Feld verteilt waren tausende und abertausende schwarze Baumstämme gepflanzt, und hinter jedem dieser Stämme erhoben sich Hügel von Gräbern. Irgendwann spürte ich unter meinen Turnschuhen Wasser, und als ich mich umdrehte, sah ich, dass von dort, wo ich das Ende des Feldes geglaubt hatte, das Meer heranströmte. Warum hatte man diese Gräber an einem solchen Ort angelegt?, fragte ich mich. Waren nicht schon die Knochen der unteren Gräber fortgespült worden? Sollten nicht wenigstens die Knochen der oberen Gräber gerettet werden, bevor es zu spät war, jetzt? Aber wie war das möglich? Ich hatte nicht einmal eine Schaufel. Das Wasser stieg schon bis zu meinen Knöcheln. Als ich aus dem Traum erwachte und aus dem noch dunklen Fenster blickte, hatte ich das Gefühl, dass mir dieser Traum etwas sehr Wichtiges mitteilen wollte. Nachdem ich den Traum aufgeschrieben hatte, dachte ich, dass dies der Anfang des nächsten Romans sein könnte.
Ohne zu wissen, welche Art von Roman es werden würde, schrieb ich immer wieder die ersten Zeilen einiger Geschichten, die aus dem Traum hervorgehen könnten, und löschte sie dann wieder. Ab Dezember 2017 lebte ich für etwa zwei Jahre in einer Mietwohnung auf Jeju, pendelte zwischen dort und Seoul. Während ich das starke Wetter der Insel mit seinem Wind, Licht sowie Regen und Schnee erlebte und durch Wälder, über Strände und Dorfgassen streifte, konnte ich spüren, wie sich die Umrisse des Romans nach und nach abzuzeichnen begannen. Ähnlich wie bei MENSCHENWERK las ich Zeugenaussagen von Überlebenden des Jeju-Massakers, studierte Material und sah mich mit grausamen Details konfrontiert, die beinah nicht in Worte zu fassen sind. Ich schrieb die Geschichte in UNMÖGLICHER ABSCHIED so zurückhaltend wie möglich nieder. Etwa sieben Jahre nach meinem Erwachen aus dem Traum mit den schwarzen Baumstämmen und dem hereinströmenden Meer wurde der Roman veröffentlicht.
In den Notizbüchern, die ich während der Arbeit an dem Roman führte, finden sich folgende Aufzeichnungen.
Leben sucht nach Leben. Das Leben ist warm.
Sterben bedeutet, kalt zu werden. Es bedeutet, dass der Schnee, der sich
auf dem Gesicht ansammelt, nicht schmilzt.
Töten bedeutet: kalt machen.
Der Mensch in der Geschichte und der Mensch im Universum.
Der Wind und die Strömungen. Der Kreislauf von Wasser und Wind, der
die ganze Welt verbindet. Wir sind verbunden. Wir sind verbunden – o
bitte, lass es so sein.
Dieser Roman besteht aus insgesamt drei Teilen. Der erste Teil beschreibt die Reise der Erzählerin Gyeongha, die von Seoul bis zum Haus von Inseon in den höhergelegenen Regionen von Jeju führt, um einen Vogel zu retten, wobei sie bereits in den Niederungen ihren horizontalen Weg durch einen heftigen Schneesturm bahnen muss. Der zweite Teil ist ein vertikaler Weg hinab in die Tiefsee, bei dem sie zusammen mit Inseon in die Dunkelheit der menschlichen Nacht hinabsteigt – in die Zeit des Massakers an Zivilisten auf Jeju im Winter 1948. Im letzten Teil, dem dritten Abschnitt, entzünden die beiden im tiefen Meer eine Kerze.
Obwohl die Freundinnen Gyeongha und Inseon gemeinsam den Roman vorantreiben, indem sie einander die Kerze überreichen, ist die wahre Protagonistin, die mit ihnen verbunden ist, Inseons Mutter, Jeongsim. Eine Überlebende des Massakers, die zu Lebzeiten darum kämpfte, auch nur ein Fragment der Knochen ihres geliebten Bruders zu finden und ihm eine letzte Ruhestätte zu geben. Sie ist diejenige, die die Trauer nicht abschließt. Diejenige, die sich dem Vergessen widersetzt, die nie Abschied nimmt. Indem ich in ihr Leben blickte – ein Leben, in dem Schmerz und Liebe mit gleicher Dichte und Hitze kochten – fragte ich mich wohl: Wie sehr können wir lieben? Wo liegt unsere Grenze? Wie sehr müssen wir lieben, um am Ende Mensch zu bleiben?
Drei Jahre sind vergangen, seit UNMÖGLICHER ABSCHIED herauskam, und noch immer habe ich den nächsten Roman nicht vollendet. Auch ein Buch, das ich nach dem Abschluss dieses Projekts schreiben möchte, wartet schon lange auf mich. Es ist ein Roman, der formal mit dem Buch WEIßverbunden ist, einem Werk, in dem ich einen Teil dessen, was in uns ist und niemals zerstört werden kann, betrachten wollte, als ich versuchte, meiner Schwester, die zwei Stunden nach ihrer Geburt starb, mein Leben für eine Weile zu leihen. Wie immer ist es nicht möglich, vorherzusagen, wann die beiden Bücher abgeschlossen sind, aber ich werde in jedem Fall weiterschreiben, wenn auch in verlangsamtem Tempo. Ich werde weiter voranschreiten, das bisherige Werk hinter mir lassend, immer weiter, bis ich irgendwann um die Ecke biege und die Bücher der Vergangenheit außer Sicht sind, soweit ich es im Rahmen meines Lebens vermag.
Während ich so weitergehe, werden auch meine Bücher, obwohl sie von mir stammen, ein eigenes Leben entfalten und ihrem eigenen Schicksal entgegengehen. Wie die beiden Schwestern, die für immer zusammen in dem Krankenwagen bleiben, in dem grüne Flammen vor dem Fenster lodern. Der Finger der Frau, die im Dunkeln und in der Stille auf die Handfläche des Mannes schreibt und bald die Sprache wiederfinden wird. Meine Schwester, die nur zwei Stunden nach ihrer Geburt starb, und meine junge Mutter, die das Baby bis zuletzt mit den Worten halten wollte: Stirb nicht, bitte stirb nicht! Wie weit werden die Seelen reisen, die mich mit einem warmen, unbeschreiblich zarten orangefarbenen Licht umhüllten, das hinter meinen geschlossenen Augenlidern ruhte? Wie weit werden die Kerzen der Menschen reisen, die an all den Orten, an denen Massaker stattfanden, und in allen Zeiten und Räumen, die von überwältigender Gewalt heimgesucht wurden, das Gelübde ablegten, nicht Abschied zu nehmen? Werden sie reisen, von Docht zu Docht, von Herz zu Herz, durch den goldenen Faden, der sie verbindet?
In dem Heftchen aus dem April 1979, das ich letztes Jahr in dem alten Schuhkarton entdeckte, hatte ich mir zwei Fragen gestellt:
Wo ist die Liebe?
Was ist die Liebe?
Andererseits hatte ich bis zum Herbst 2021, als Unmöglicher Abschied erschien, immer gedacht, dass die folgenden zwei Fragen der Kern meines Denkens waren:
Warum ist die Welt so gewalttätig und schmerzvoll?
Wie kann die Welt gleichzeitig so schön sein?
Ich glaubte lange, die Spannung zwischen diesen beiden Fragen und der innere Kampf seien der Motor meines Schreibens. Von meinem ersten bis zu meinem jüngsten Roman haben sich die Fragen stets verändert und sind vorangeschritten, aber diese beiden blieben konstant, dachte ich. Doch seit ein, zwei Jahren beginne ich, an dieser Überzeugung zu zweifeln. Hatte ich nach der Veröffentlichung von MENSCHENWERK im Frühjahr 2014 wirklich zum ersten Mal über die Liebe – über den Schmerz, der uns verbindet – nachgedacht? War womöglich von meinem ersten bis zu meinem jüngsten Roman, die tiefste Schicht aller meiner Fragen, immer auf die Liebe ausgerichtet? War sie nicht der älteste und grundlegendste Akkord meines Lebens?
Im April 1979 schrieb das Kind: Die Liebe befindet sich an einem persönlichen Ort, genannt mein Herz – mein klopfendes Herz. Und in Bezug darauf, was diese Liebe ausmacht, antwortete es: Ein goldener Faden, der Herz mit Herz verbindet.
Wenn ich schreibe, benutze ich meinen Körper. Ich setze alle Sinne ein: sehen, hören, riechen, schmecken, das Gefühl von Weichheit, Wärme, Kälte und Schmerz, den Herzschlag, Durst und Hunger zu empfinden, zu gehen, zu laufen, den Wind, sowie Regen und Schnee zu spüren, Hände zu halten. Ich bemühe mich, all diese lebendigen Empfindungen, die ich als sterbliches Wesen mit warmem, pulsierendem Blut fühle, in die Sätze fließen zu lassen wie elektrischen Strom, und jedes Mal, wenn ich spüre, dass diese Ladung auf den Leser überspringt, bin ich erstaunt und bewegt. Der Moment, in dem ich realisiere, dass die Sprache der Faden ist, der uns einander nahe bringt und dass meine Fragen die Ladung sind, die den Faden zum Leuchten bringen und so die Verbindung schaffen, erfüllt mich mit Dankbarkeit. Ich danke von Herzen allen, die mit diesem Faden verbunden sind und sich auch weiterhin mit ihm verbinden werden.
www.aufbau-verlage.de/aufbau/im-gespraech/han-kangs-nobelpreisrede
Han Kang: DIE VEGETARIERIN. Roman. Aus dem Koreanischen von Ki-Hyang Lee.
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2016